

Blockheizkraftwerke produzieren zeitgleich Strom und Wärme und arbeiten dabei höchst energieeffizient und ressourcensparend. Dafür sind sie in der Anschaffung jedoch etwas teurer als viele andere Heizsysteme. Buderus verrät Ihnen genaueres zu den Kosten eines BHKWs sowie zu den Fördermöglichkeiten.
Das kostet ein BHKW in der Anschaffung und Installation

Die Anschaffungskosten eines Blockheizkraftwerks sind von verschiedenen Faktoren abhängig, vorrangig von der Größe.
- Kleine Anlagen, die der Versorgung eines kleinen Mehrfamilienhauses oder Gewerbebetriebes dienen – so genannte Nano- oder Mikro-BHKWs – sind bereits ab etwa 25.000,- Euro erhältlich.
Hinzu kommt die Installation der Systeme, für die noch einmal rund 5.000 Euro anfallen. Je nachdem, welchen Brennstoff Sie für das BHKW nutzen wollen, können sich weitere Kostenpunkte ergeben.
Für einen Betrieb mit Erdgas ist selbstverständlich ein entsprechender Gasanschluss erforderlich. Zudem ist in jedem Fall eine Abgasleitung vonnöten. Ziehen Sie eventuell auch einen Pufferspeicher für die Heizanlage in Erwägung – dieser sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeversorgung und optimiert die Stromerzeugung.
Welche Kosten entstehen im Betrieb des BHKW?
Beim Betrieb eines BHKWs fallen diverse Kosten an, etwa für den genutzten Energieträger oder die Wartung. Je nachdem, welcher Brennstoff zur Strom- und Wärmeerzeugung verfeuert wird, welche Leistung die Anlage aufweist und wie viele Stunden sie im Jahr läuft, können die laufenden Kosten daher stark variieren.
Ungefähre Preise für Heizstoffe:
- Erdgas: 15 ct/kWh
Zur Berechnung der Kosten für ein BHKW pro kWh müssen Sie den Preis für den genutzten Energieträger lediglich mit dem Verbrauch der Anlage multiplizieren.
Kosten = Verbrauch in kWh * Preis Energieträger/kWh
Größere BHKW sind etwas wirtschaftlicher als kleine Systeme.
Wartung von BHKWs
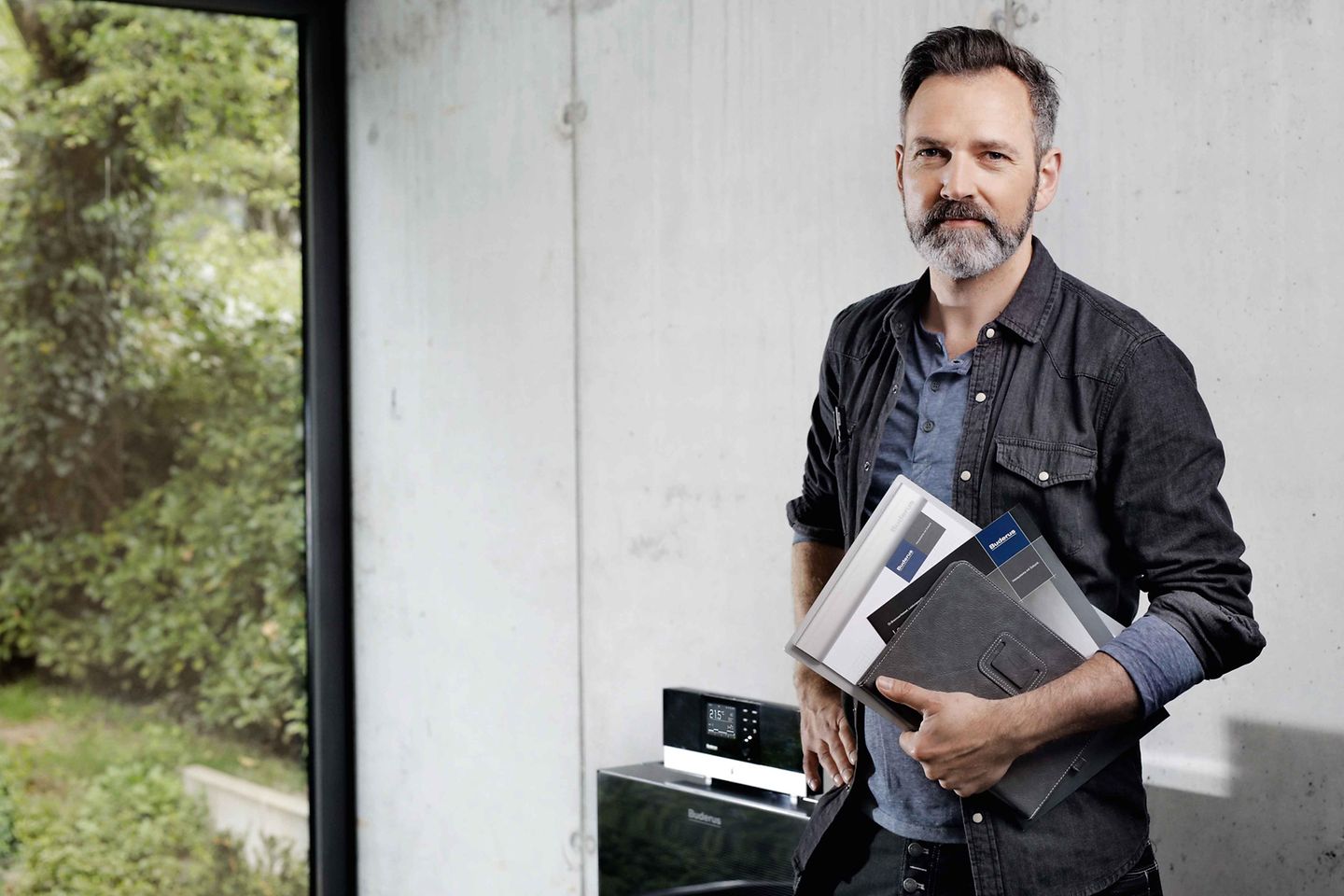
Wie hoch die Wartungskosten ausfallen, hängt von der elektrischen Leistung sowie der jährlichen Laufzeit des BHKWs ab. Pro Kilowattstunde können Sie mit etwa 3 Cent rechnen. Je nach genutzter Technik werden jedoch unterschiedliche Wartungsintervalle empfohlen – so sollte ein BHKW alle 2.000 bis 4.000 Betriebsstunden inspiziert werden, bei einer kleineren Anlage genügt eine Wartung auch alle 5.000 bis 10.000 Stunden Laufzeit.
Einspeisevergütung
Beim Betrieb eines BHKWs fallen nicht nur Kosten an, es lässt sich mit den Anlagen ebenfalls auch Geld verdienen. Wenn Sie den erzeugten elektrischen Strom nicht selbst verbrauchen, sondern in das öffentliche Stromnetz leiten, erhalten Sie dafür eine Einspeisevergütung*.
Diese setzt sich zusammen aus:
KWK-Zuschlag (Systeme bis 50 kWe): 16 ct/kWh
Vergütung für eingespeisten Strom (zeitabhängig): ca. 3-10 ct/kWh
Maximale Vergütung: rund 25 ct/kWh (gerundet)
Strom-Eigenverbrauch
Da vom Netzbetreiber bezogener Strom jedoch mit rund 35 bis 40 ct/kWh zu Buche schlägt, ist es wirtschaftlicher, selbst erzeugten Strom weitgehend selbst zu verbrauchen und lediglich nicht nutzbare Überschüsse ins Netz einzuspeisen. Für den selbst genutzen Strom bei Systemen bis 50 kW/e erhält der Betreiber einen KWK-Zuschlag von 8 ct/kWh für insgesamt maximal 30.000 Vollbenutzungsstunden.
*Zahlen von Q3/2025
Wie werden Blockheizkraftwerke gefördert?
Da es sich bei Blockheizkraftwerken um energieeffiziente und ressourcensparende Systeme zur Energieerzeugung handelt, bietet der Staat verschiedene Fördermaßnahmen an.
Häufig gestellte Fragen zu den Kosten eines BHKW
-
Im Durchschnitt wird die Lebensdauer der Anlagen auf 10 bis 15 Jahre beziffert, bevor eine Generalüberholung nötig ist. Mit der richtigen Pflege ist jedoch auch ein Betrieb über 20 Jahre und länger möglich. Wie lange ein BHKW betrieben werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa der genutzten Technik, der Betriebszeit und Fahrweise, Umweltbedingungen und Einhaltung der Wartungsintervalle. Stirlingmotoren sind hier grundsätzlich langlebiger als normale Verbrennungsmotoren und bedürfen auch einer späteren Grundrevision.
-
Mit einem Pufferspeicher können Sie Heizwärme bevorraten und Temperaturschwankungen ausgleichen, so dass das BHKW nicht so oft anspringen muss. Die Kosten für den Speicher richten sich dabei nach der Bauart und dem Volumen. Prinzipiell sollten Sie pro Kilowatt thermischer Leistung des BHKW etwa 50 bis 70 Liter Speichervolumen einplanen.